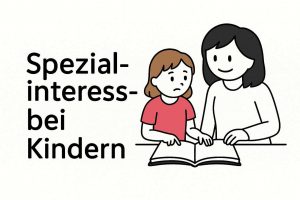Wenn ein Kind außergewöhnlich klug ist, aber beim Lesen und Schreiben stolpert, führt das oft zu Verwirrung, bei Eltern, Lehrkräften und dem Kind selbst. Hochbegabung und Lese-Rechtschreibschwäche scheinen auf den ersten Blick Gegensätze zu sein. Doch sie können tatsächlich gemeinsam auftreten, und genau das macht die Situation so komplex.
Viele dieser Kinder denken schneller, erkennen Zusammenhänge intuitiv und überraschen mit erstaunlichen Ideen. Gleichzeitig kämpfen sie mit Buchstaben, Lauten und Rechtschreibregeln, die ihnen einfach nicht „greifbar“ erscheinen. Ihre hohe Intelligenz ermöglicht es ihnen anfangs, Schwierigkeiten zu kompensieren, doch mit zunehmendem Schulstoff werden die Hürden sichtbar. Lehrerinnen und Lehrer stehen dann vor der Frage: Wie kann ein Kind so klug sein und trotzdem so viele Rechtschreibfehler machen?
In diesem Artikel erfährst du,
wie Hochbegabung und Leserechtschreibschwäche zusammenhängen
warum diese Kombination häufig zu Fehldiagnosen führt
wie du erkennst, ob dein Kind betroffen sein könnte
welche Förderstrategien wirklich helfen und was der Schule dabei eine Schlüsselrolle gibt
Was bedeutet Leserechtschreibschwäche (LRS)?
Die Leserechtschreibschwäche, kurz LRS, ist eine der häufigsten Lernstörungen im schulischen Bereich. Sie betrifft Kinder, die beim Lesen und Schreiben trotz normaler oder sogar überdurchschnittlicher Intelligenz deutlich mehr Schwierigkeiten haben als andere. Buchstaben werden verwechselt, Wörter falsch abgeschrieben oder beim Lesen erraten. Viele Eltern sind überrascht, wenn sie erfahren, dass auch Kinder mit Hochbegabung und Lese-Rechtschreibschwäche betroffen sein können.
Ursache ist keine mangelnde Übung, sondern eine neurobiologische Besonderheit im Gehirn. Bestimmte Bereiche, die für Lautverarbeitung und Sprachverständnis zuständig sind, arbeiten anders als bei Kindern ohne LRS. Dadurch fällt es schwer, Laute mit Buchstaben zu verknüpfen. Auch genetische Faktoren spielen häufig eine Rolle. Eine reine Nachhilfe oder mehr Schreibtraining reicht daher meist nicht aus, um die Schwierigkeiten zu beheben.dann vor der Frage: Wie kann ein Kind so klug sein und trotzdem so viele Rechtschreibfehler machen?
Von einer echten Leserechtschreibschwäche spricht man, wenn die Probleme dauerhaft bestehen und nicht durch zusätzliche Übung verschwinden. Deshalb ist eine frühzeitige Diagnostik wichtig. Je eher LRS erkannt wird, desto gezielter kann das Kind unterstützt und entlastet werden, besonders dann, wenn gleichzeitig eine Hochbegabung vorliegt.
Kann man hochbegabt sein und Leserechtschreibschwäche haben?
Ja, das ist möglich. Hochbegabung und Leserechtschreibschwäche können gleichzeitig auftreten, auch wenn das auf den ersten Blick widersprüchlich klingt. Fachleute sprechen in diesem Fall von einer „doppelten Besonderheit“. Kinder mit dieser Kombination besitzen ein außergewöhnlich hohes Denkvermögen, haben aber gleichzeitig erhebliche Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Genau diese Gegensätze machen eine eindeutige Einschätzung oft schwierig.
Viele Kinder mit Hochbegabung und Legasthenie lernen zunächst, ihre Probleme zu verbergen. Sie merken sich ganze Wörter, statt sie lautgetreu zu lesen, oder sie kompensieren Fehler durch ein gutes Sprachgefühl. Diese Strategien funktionieren häufig bis zur dritten oder vierten Klasse. Später, wenn Texte komplexer werden, zeigen sich die Schwierigkeiten jedoch deutlich. Dann werden Kinder, die zuvor als sehr leistungsstark galten, plötzlich unsicher und verlieren an Selbstvertrauen.
Besonders problematisch ist, dass Lehrkräfte und Eltern die Symptome manchmal falsch deuten. Wenn ein hochbegabtes Kind viele Rechtschreibfehler macht, wird das schnell als Nachlässigkeit, Unkonzentriertheit oder Faulheit interpretiert. Tatsächlich steckt aber eine tiefgreifende Lernstörung dahinter. Eine genaue Diagnostik ist deshalb entscheidend, um die Hochbegabung und die Lese-Rechtschreibschwäche gleichermaßen zu erkennen und individuell zu fördern.
Welche Schwierigkeiten haben hochbegabte Kinder mit Leserechtschreibschwäche?
Kinder mit Hochbegabung und Legasthenie erleben im Schulalltag häufig widersprüchliche Situationen. Ihr Denken ist außergewöhnlich schnell und komplex, aber ihre schriftliche Ausdrucksfähigkeit kann mit dieser Geschwindigkeit nicht mithalten. Während sie inhaltlich brillieren, scheitern sie an der Rechtschreibung oder am langsamen Lesen. Dieser Widerspruch führt oft zu Frustration und Selbstzweifeln.
Viele dieser Kinder wissen sehr genau, dass sie klug sind, können ihre Fähigkeiten aber nicht zeigen. Sie erkennen ihre eigenen Fehler, haben jedoch keine Strategien, sie zu vermeiden. In Diktaten, Aufsätzen oder Tests fallen sie deshalb trotz großer Anstrengung auf. Lehrkräfte und Eltern bemerken dann, dass das Kind mündlich glänzt, schriftlich aber weit hinter seinen Möglichkeiten bleibt. Diese Diskrepanz ist eines der auffälligsten Merkmale bei Hochbegabung und Lese-Rechtschreibschwäche.
Hinzu kommen emotionale und soziale Belastungen. Manche Kinder ziehen sich zurück, weil sie sich ständig erklären müssen. Andere entwickeln Perfektionismus oder Versagensängste. Wenn die Lehrkraft ihre Schwierigkeiten nicht versteht, kann daraus schnell ein Teufelskreis entstehen: sinkendes Selbstwertgefühl, Vermeidungsverhalten und nachlassende Motivation. Umso wichtiger ist eine schulische Umgebung, die sowohl die Hochbegabung als auch die Lese-Rechtschreibschwäche anerkennt und gezielt unterstützt.
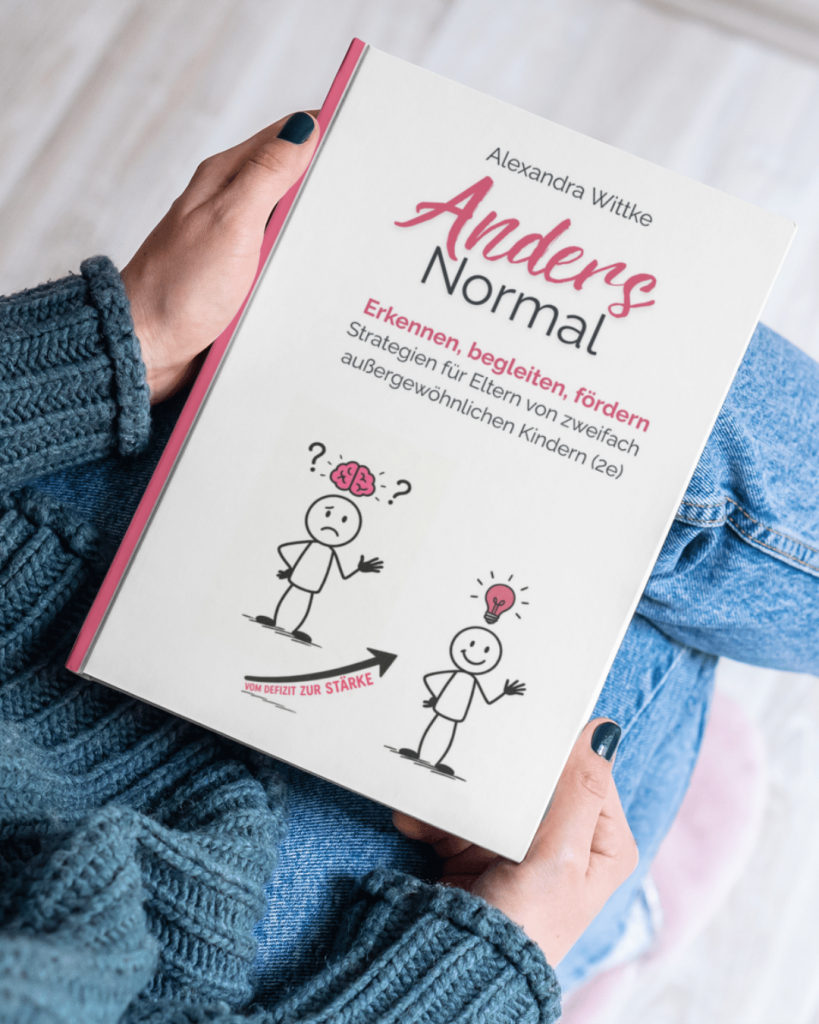
Anders Normal
Erkennen, begleiten, fördern
Dein Kind ist nicht schwierig, es ist nur anders!
„Anders Normal“ ist der erste deutschsprachige Praxisleitfaden für Eltern von zweifach besonderen Kindern – Kindern, die gleichzeitig hochbegabt und neurodivergent sind, etwa mit ADHS, Autismus oder einer Lernstörung.
Das Buch zeigt dir Schritt für Schritt,
wie du erkennst, was Twice Exceptionality (2e) wirklich bedeutet,
wie du Diagnostik und Gespräche mit Lehrkräften souverän führst,
und wie du dein Kind im Alltag, in Schule und Familie stärken kannst.
Mit verständlichem Fachwissen, echten Fallbeispielen und klaren Strategien bekommst du einen Werkzeugkoffer, um das Potenzial deines Kindes zu entfalten – ohne Druck, aber mit Struktur, Herz und Klarheit.
„Anders Normal“ ist kein theoretisches Fachbuch, sondern eine liebevolle Orientierungshilfe für Eltern, die endlich verstehen wollen, warum ihr außergewöhnliches Kind nicht in gewöhnliche Schubladen passt.
Welche Auswirkungen hat eine Leserechtschreibschwäche auf die Intelligenz?
Eine Leserechtschreibschwäche hat keine Auswirkungen auf die Intelligenz eines Kindes. Hochbegabung und Leserechtschreibschwäche schließen sich nicht aus, auch wenn viele Menschen das vermuten. Kinder mit LRS verfügen über ein normales oder überdurchschnittliches Denkvermögen. Die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben entstehen nicht durch mangelndes Wissen, sondern durch eine andere Art der Informationsverarbeitung im Gehirn.
Bei der Diagnostik ist es wichtig, beide Bereiche getrennt zu betrachten. Wenn ein Intelligenztest ohne Berücksichtigung der LRS durchgeführt wird, kann das Ergebnis verfälscht sein. Manche Kinder schneiden schlechter ab, weil sie Aufgaben schriftlich bearbeiten müssen oder sich zu sehr auf ihre Fehler konzentrieren. Ein qualifizierter Diagnostiker berücksichtigt deshalb, welche Tests für Kinder mit Leserechtschreibschwäche geeignet sind, um die tatsächliche Begabung sichtbar zu machen.
Richtig erkannt, kann eine Hochbegabung mit Legasthenie sogar zu besonderen Denkwegen führen. Viele dieser Kinder entwickeln kreative Lösungsstrategien, haben ein starkes Vorstellungsvermögen und denken ungewöhnlich vernetzt. Wenn sie gezielt gefördert werden, lernen sie, ihre Stärken zu nutzen und die LRS als Teil ihres individuellen Lernprofils zu verstehen, nicht als Schwäche.
Wie hängen Hochbegabung, Leserechtschreibschwäche und Legasthenie zusammen?
Kinder mit Hochbegabung und Leserechtschreibschwäche gehören zu einer besonderen Gruppe, die in der Fachsprache auch als „twice exceptional“ oder kurz 2e bezeichnet wird. Das bedeutet, dass bei einem Kind sowohl außergewöhnliche Stärken als auch Lernherausforderungen gleichzeitig bestehen.
In diesem Fall treffen überdurchschnittliche kognitive Fähigkeiten auf Schwierigkeiten im Bereich Lesen und Schreiben, die häufig als Legasthenie diagnostiziert werden.
Legasthenie ist eine spezielle Form der Leserechtschreibschwäche, die auf neurobiologischen Ursachen beruht. Sie äußert sich durch anhaltende Probleme beim Erkennen und Verarbeiten von Buchstaben und Lauten. Hochbegabte Kinder mit Legasthenie kompensieren diese Schwäche häufig über Jahre hinweg, indem sie sich Wörter visuell einprägen oder Inhalte auswendig lernen. Ihr hohes Denkvermögen hilft ihnen, schulische Anforderungen zu überbrücken, bis der Stoff komplexer wird und die Defizite plötzlich sichtbar werden.
Gerade hier zeigt sich, warum das Verständnis von 2e-Kindern so wichtig ist. Eine isolierte Betrachtung der Leserechtschreibschwäche führt schnell zu Fehleinschätzungen. Wird nur auf die Schwäche geschaut, bleibt die Hochbegabung unentdeckt. Wird nur die Begabung gesehen, bleibt die Legasthenie unbehandelt. Erst wenn beide Seiten gleichermaßen berücksichtigt werden, kann eine gezielte Förderung entstehen, die den individuellen Lernstil und die emotionalen Bedürfnisse des Kindes wirklich versteht.
Diagnose: Wie wird Hochbegabung mit Leserechtschreibschwäche erkannt?
Die Diagnose einer Hochbegabung mit Lese-Rechtschreibschwäche ist komplex, weil sich die Stärken und Schwächen gegenseitig verdecken können. Viele Kinder mit außergewöhnlicher Intelligenz gleichen ihre Probleme im Lesen und Schreiben über lange Zeit aus. Erst wenn die Anforderungen steigen, etwa ab der dritten oder vierten Klasse, zeigen sich die Schwierigkeiten deutlicher.
Für eine verlässliche Einschätzung braucht es eine ganzheitliche Diagnostik, die sowohl die intellektuellen Fähigkeiten als auch die Lese- und Rechtschreibleistungen erfasst. Dazu gehören in der Regel ein Intelligenztest, ein standardisierter Lese- und Rechtschreibtest sowie eine Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprüfung. Entscheidend ist, dass diese Tests von Fachleuten durchgeführt werden, die Erfahrung mit doppelt außergewöhnlichen Kindern haben.
Das Deutsche Bündnis Legasthenie und Dyskalkulie (BVL) betont in seinen Leitlinien, dass Kinder mit LRS oder Legasthenie differenziert betrachtet werden müssen, um Fehldiagnosen zu vermeiden. Eine zu frühe oder einseitige Beurteilung kann dazu führen, dass Hochbegabung übersehen wird oder die LRS nicht ernst genug genommen wird.
Im Idealfall arbeiten Schule, Eltern, Psychologen und Lerntherapeuten eng zusammen. So kann ein Förderplan entstehen, der beide Seiten der Begabung berücksichtigt: die außergewöhnliche Denkfähigkeit und die besonderen Lernbedürfnisse. Nur wenn das Kind in seiner gesamten Persönlichkeit gesehen wird, ist eine nachhaltige Förderung möglich.
Förderung und Unterstützung für Kinder mit Hochbegabung und Leserechtschreibschwäche
Kinder mit Hochbegabung und Leserechtschreibschwäche brauchen eine Förderung, die beides berücksichtigt, ihre besonderen Fähigkeiten ebenso wie ihre individuellen Lernschwierigkeiten. Eine einseitige Förderung, die sich nur auf das eine oder das andere konzentriert, greift zu kurz. Ziel ist, das Kind als Ganzes zu stärken, sein Selbstvertrauen aufzubauen und ihm Strategien an die Hand zu geben, mit seiner besonderen Lernsituation umzugehen.
Ein bewährter Ansatz ist die spezialisierte Lerntherapie, die auf Kinder mit LRS oder Legasthenie zugeschnitten ist. Hier lernen sie, Sprache und Schrift systematisch zu verstehen und zu verarbeiten. Dabei werden Übungen mit spielerischen Elementen kombiniert, um Motivation und Erfolgserlebnisse zu fördern. Hochbegabte Kinder profitieren besonders, wenn die Lerninhalte an ihr kognitives Niveau angepasst sind. Ein zu einfaches Training führt sonst schnell zu Langeweile und Frust.
Gleichzeitig sollte die Förderung die Stärken des Kindes bewusst einbeziehen. Kreative Projekte, logisches Denken oder das eigenständige Forschen können helfen, Selbstwirksamkeit zu erleben. In der Schule ist es wichtig, dass Lehrkräfte Verständnis zeigen und den Lernprozess individuell begleiten. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrkräften und Therapeutinnen ist der Schlüssel, um eine Leserechtschreibschwäche trotz Hochbegabung erfolgreich zu bewältigen.
Nachteilsausgleich und schulische Unterstützung
Ein Nachteilsausgleich ist eine schulische Maßnahme, die sicherstellen soll, dass Kinder mit einer diagnostizierten Legasthenie trotz ihrer Schwierigkeiten faire Chancen haben. Für Kinder mit Hochbegabung und Lese-Rechtschreibschwäche ist dieser Ausgleich besonders wichtig, weil ihre tatsächlichen Fähigkeiten sonst nicht sichtbar werden. Ziel ist es nicht, einen Vorteil zu verschaffen, sondern die Benachteiligung auszugleichen, die durch die LRS entsteht.
Beispiele für einen Nachteilsausgleich sind eine verlängerte Arbeitszeit bei Klassenarbeiten, die Reduzierung der Rechtschreibbewertung in Aufsätzen oder das Nachdiktieren von Texten am Computer, wenn das Schreiben per Hand zu viel Zeit kostet. Manche Schulen erlauben auch mündliche statt schriftlicher Leistungsnachweise, wenn ein Kind sein Wissen besser durch Sprache zeigen kann. Solche Anpassungen können helfen, die Kluft zwischen der hohen Denkfähigkeit und den schriftsprachlichen Schwierigkeiten zu überbrücken.
Die rechtliche Grundlage für Nachteilsausgleiche variiert je nach Bundesland. Grundlage sind meist die schulrechtlichen Bestimmungen zur individuellen Förderung bei besonderen Lernvoraussetzungen. Orientierung bieten die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) sowie die Handreichungen der Landesbildungsserver. Beispielhaft verweist das Ministerium für Schule und Bildung NRW in seiner Broschüre „Fördern – Fordern – Begleiten“ darauf, dass Schülerinnen und Schüler mit einer LRS Anspruch auf individuelle Unterstützung und angemessene Leistungsbewertung haben
Auch der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie (BVL) rät dazu, den Nachteilsausgleich frühzeitig zu beantragen und gemeinsam mit der Schule individuell zu gestalten. Wichtig ist, dass die Maßnahmen regelmäßig überprüft werden, damit sie zur tatsächlichen Entwicklung des Kindes passen. Wenn Schule und Eltern offen zusammenarbeiten, kann aus der Kombination von Hochbegabung und Lese-Rechtschreibschwäche kein Hindernis, sondern eine Chance werden, Stärken sichtbar zu machen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufzubauen.
Hochbegabung und Leserechtschreibschwäche verstehen und fördern
Hochbegabung und Lese-Rechtschreibschwäche sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten einer besonderen Begabung. Kinder, die beides in sich vereinen, denken oft schneller, kreativer und komplexer als andere. Gleichzeitig stoßen sie im schulischen Alltag auf Hindernisse, die ihr Potenzial verdecken können. Wenn Lehrkräfte, Eltern und Fachkräfte jedoch beide Aspekte erkennen, entsteht ein ganz neues Verständnis für diese Kinder. Eines, das auf Stärken aufbaut statt auf Schwächen zu schauen.
Eine frühzeitige, ganzheitliche Diagnostik und eine passgenaue Förderung sind entscheidend. Lerntherapie, Nachteilsausgleich und eine wertschätzende Haltung können dazu beitragen, dass betroffene Kinder nicht an sich zweifeln, sondern Selbstvertrauen entwickeln. Schulen, die auf individuelle Lernvoraussetzungen eingehen, ermöglichen es diesen Kindern, ihr außergewöhnliches Potenzial zu entfalten, auch wenn sie beim Lesen oder Schreiben mehr Zeit benötigen.