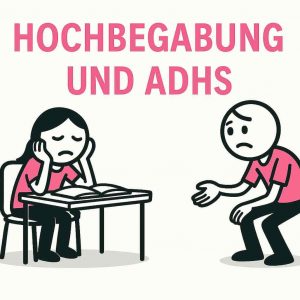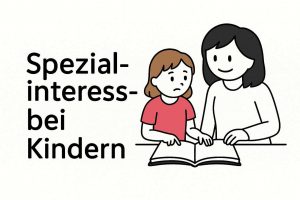Manche Kinder begeistern durch außergewöhnliche Ideen, komplexes Denken und ein unstillbares Interesse an allem Neuen. Und gleichzeitig fällt es ihnen schwer, still zu sitzen, Aufgaben zu beenden oder sich zu konzentrieren. Diese scheinbaren Widersprüche führen oft zu Ratlosigkeit: Ist es Hochbegabung, ADHS, oder vielleicht beides? Genau hier beginnt ein Phänomen, das viele Eltern und Lehrkräfte beschäftigt, aber in Deutschland noch zu wenig verstanden wird.
Kinder, die sowohl hochbegabt als auch von ADHS betroffen sind, gelten als „Twice Exceptional“, also doppelt außergewöhnlich. Sie verfügen über ein enormes intellektuelles Potenzial, das sich jedoch hinter Unruhe, Impulsivität oder Desorganisation verstecken kann. Ohne passende Förderung und Verständnis werden ihre Stärken häufig übersehen, und ihre Herausforderungen missinterpretiert. Das kann zu Schulproblemen, Frustration und einem geschwächten Selbstwertgefühl führen.
In diesem Artikel erfährst du, woran du Hochbegabung und ADHS erkennst, wie sie sich überschneiden und warum eine genaue Betrachtung so entscheidend ist:
✅ Wie sich ADHS bei hochbegabten Kindern äußert und warum sie oft missverstanden werden
✅ Wie viele Hochbegabte tatsächlich von ADHS betroffen sind – und warum die Zahlen variieren
✅ Welche Anzeichen zu Fehldiagnosen führen können
✅ Welche Unterstützung hilft, wenn beides vorliegt
Was ist der Unterschied zwischen Hochbegabung und ADHS?
Auf den ersten Blick können Hochbegabung und ADHS ähnlich wirken. Beide Kindergruppen fallen durch ungewöhnliche Denkweisen, Energie und Kreativität auf. Sie stellen viele Fragen, denken quer, sind schnell gelangweilt und reagieren empfindlich auf Ungerechtigkeit. Doch die Ursachen hinter diesen Verhaltensweisen sind sehr unterschiedlich.
Ein hochbegabtes Kind besitzt eine außergewöhnlich schnelle Auffassungsgabe und kann komplexe Zusammenhänge intuitiv erfassen. Es denkt vernetzt, stellt ungewöhnliche Verbindungen her und zeigt oft eine tiefe emotionale Intensität. Wenn dieses Kind in der Schule unterfordert ist, wirkt es unkonzentriert, redet viel oder träumt vor sich hin. Das Verhalten entsteht nicht aus Unfähigkeit, sondern aus mangelnder Herausforderung.
Bei einem Kind mit ADHS liegt die Ursache in einer neurobiologischen Besonderheit, die Aufmerksamkeit, Impulskontrolle und Selbstorganisation beeinflusst. Diese Kinder können sich durchaus konzentrieren, aber nur in Situationen, die sie besonders stark interessieren oder stimulieren. Im Gegensatz zu hochbegabten Kindern bleibt die Unruhe auch dann bestehen, wenn sie geistig gefordert werden.
Der entscheidende Unterschied zwischen Hochbegabung und ADHS liegt also darin, dass sich die Symptome bei Hochbegabung verändern, sobald das Kind intellektuell gefordert wird. Bei ADHS hingegen bleiben sie bestehen, unabhängig vom Thema oder Schwierigkeitsgrad.
Wie äußert sich ADHS bei einem hochbegabten Kind?
Bei der Kombination von Hochbegabung und ADHS kommt es häufig zu einem Spannungsfeld zwischen enormem Potenzial und großen Herausforderungen. Ein Kind mit beidem kann beispielsweise eine rasche Auffassungsgabe besitzen, aber gleichzeitig Schwierigkeiten, Aufgaben zu beenden oder sich über längere Zeit strukturiert zu organisieren. Dies liegt daran, dass bei ADHS beeinträchtigte Funktionen wie Aufmerksamkeit, Impulskontrolle oder Selbstorganisation bestehen, die auch bei hochbegabten Kindern auftreten können.
Ein wichtiger Hinweis: Bei hochbegabten Kindern mit ADHS können Symptome zunächst weniger auffallen, weil ihre Begabung viele typische ADHS-Anzeichen kompensieren kann. Eine Studie fand heraus, dass hochintelligente Kinder mit ADHS in zentralen kognitiven Tests ähnliche Defizite zeigten wie Kinder mit ADHS und durchschnittlicher Intelligenz. Diese Maskierung macht es erforderlich, genau hinzusehen, insbesondere wenn das Kind intellektuell unterfordert ist und deshalb Verhaltensweisen zeigt, die typischerweise nicht mit Hochbegabung assoziiert werden.
Im Alltag können sich typische Verhaltensmuster folgendermaßen zeigen:
Intensives Interesse, das schnell in Frust umschlägt, wenn das Thema nicht weitergedacht wird
Plötzlicher Wechsel von hoher Konzentration zu Ablenkung oder Unruhe
Schwierigkeiten, „Routineaufgaben“ oder langweilige Aufgaben durchzuhalten, selbst wenn das Kind sehr leistungsfähig ist
Häufiges „Abkippen“ in Tagträume oder Vermeidung von Aufgaben, obwohl das Kind intellektuell überfordert wäre
Wenn diese Muster bei einem hochbegabten Kind auftreten, ist es wichtig, beide Ebenen (Hochbegabung und ADHS) gemeinsam zu betrachten. Nur so lässt sich vermeiden, dass z. B. Unterforderung fälschlich als ADHS gedeutet wird oder umgekehrt. Studien zeigen, dass bei hochbegabten Kindern mit ADHS eine differenzierte Diagnostik nötig ist, weil Standard-Normwerte häufig nicht ausreichend sind.
Wie viel Prozent der Hochbegabten haben ADHS?
Die Frage, wie häufig Hochbegabung und ADHS gemeinsam auftreten, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Fachleute sprechen hier von einer sogenannten „Komorbidität“, also dem gleichzeitigen Auftreten zweier unterschiedlicher Merkmale. Studien zeigen, dass der Anteil von ADHS unter hochbegabten Kindern je nach Diagnosekriterium und Untersuchungsmethode stark schwankt.
Eine Forschungsübersicht der Universität Nijmegen kommt zu dem Ergebnis, dass zwischen 5 und 10 Prozent der hochbegabten Kinder auch eine ADHS-Diagnose erhalten. Bei Kindern mit ADHS zeigt sich umgekehrt, dass etwa 8 bis 15 Prozent überdurchschnittlich intelligent oder hochbegabt sind.
Andere Untersuchungen, etwa eine deutsche Studie des ICBF Münster, betonen, dass hochbegabte Kinder durch ihre kognitiven Ressourcen lange in der Lage sind, typische ADHS-Symptome zu kompensieren. Dadurch wird die Diagnose häufig erst spät oder gar nicht gestellt (ICBF, Universität Münster, 2018
Zusammengefasst lässt sich sagen: Hochbegabung und ADHS schließen sich nicht aus. Im Gegenteil, sie können sich gegenseitig beeinflussen. Eine exakte Zahl ist schwer zu nennen, doch Fachleute gehen davon aus, dass ein relevanter Anteil hochbegabter Kinder auch ADHS-Merkmale zeigt. Entscheidend ist, beide Bereiche differenziert zu betrachten, damit keine Seite übersehen wird, weder die besondere Begabung noch die Aufmerksamkeitsproblematik.
Kann Hochbegabung mit ADHS verwechselt werden?
Die kurze Antwort lautet: Ja, Hochbegabung kann mit ADHS verwechselt werden. Und umgekehrt kann ADHS bei hochbegabten Kindern übersehen werden. Genau das macht Hochbegabung und ADHS so schwer voneinander abzugrenzen. Für Eltern bedeutet das oft eine jahrelange Odyssee zwischen Schule, Kinderarzt, Psychologin und Förderempfehlungen, die nicht passen.
Unterforderung kann wie Unaufmerksamkeit aussehen
Ein hochbegabtes Kind versteht den Unterrichtsstoff manchmal schon nach wenigen Minuten. Der Rest der Stunde ist für das Kind Leerlauf. Was passiert dann? Es stört, redet dazwischen, träumt weg, bastelt im Mäppchen herum oder schaut aus dem Fenster. Genau dieses Verhalten wirkt auf Außenstehende wie klassische Unaufmerksamkeit oder Hyperaktivität.
In der Forschung wird beschrieben, dass dauerhafte Unterforderung zu Unruhe, Provokation oder kompletter Arbeitsverweigerung führen kann. Das wird dann schnell als ADHS gedeutet, obwohl die Ursache eigentlich intellektuelle Langeweile ist.
Das Problem dabei: Wenn Schule und Eltern annehmen, es handele sich bei diesen Impulsen um reine Verhaltensauffälligkeit, wird selten an Förderung gedacht. Stattdessen wird das Kind als „unkonzentriert“ oder „stört absichtlich“ eingeordnet. Studien betonen, dass Überdruss im Unterricht häufig fälschlich als Aufmerksamkeitsstörung interpretiert wird.
Asynchrone Entwicklung wird als „Regulationsproblem“ gewertet
Hochbegabte Kinder sind oft kognitiv sehr weit, emotional aber nicht unbedingt. Ein Kind kann über komplexe moralische Fragen diskutieren, aber gleichzeitig bei einer simplen Hausaufgabe in Tränen ausbrechen. Diese Ungleichzeitigkeit der Entwicklung wird als asynchrone Entwicklung beschrieben. Sie bedeutet: Kopf und Emotion sind nicht immer im gleichen Alter. Genau diese emotionale Intensität, Frustrationstoleranz und Impulsivität kann nach außen wie ein Steuerungsproblem wirken, das häufig mit ADHS in Verbindung gebracht wird. Das führt in der Praxis dazu, dass Kinder vorschnell als verhaltensauffällig gelten, obwohl sie eigentlich überfordert sind mit der eigenen Intensität, nicht mit der Aufgabe.
„Schnell denken“ wirkt wie „impulsiv antworten“
Viele hochbegabte Kinder antworten blitzschnell, fallen anderen ins Wort und korrigieren Lehrkräfte. Das wirkt wie Impulsivität, also ein Kernkriterium von ADHS. In der Diagnostik wird genau das beschrieben: Es ist oft schwer zu unterscheiden, ob ein Kind impulsiv platzt, weil es Impulskontrollschwierigkeiten hat, oder ob es schlicht kognitiv zwei Schritte weiter ist und nicht aushält, dass der Rest der Klasse noch über Schritt eins spricht. Fachliteratur beschreibt, dass bei hochbegabten Kindern Merkmale wie schnelle Antworten, Drang zum Sprechen, Ungeduld und Lehrer-Korrekturen fälschlich als ADHS-Symptom gewertet werden können.
Das macht die Lage so heikel: Die Verhaltensbeobachtung allein reicht nicht aus. Man muss die Situation betrachten, in der das Verhalten auftritt.
Fehldiagnose in beide Richtungen
Es gibt zwei typische Fehler.
Fehler Nummer eins:
Ein Kind ist hochbegabt, unterfordert und verhält sich unruhig. Die Schule vermutet ADHS, obwohl das Verhalten verschwindet, sobald das Kind wirklich gefordert wird. In diesen Fällen bekommt das Kind manchmal eine ADHS-Vermutung, obwohl eigentlich eine Talentförderung nötig wäre. Mehrere Studien und Fachberichte warnen davor, dass Hochbegabung vorschnell pathologisiert wird, wenn Erwachsene Intensität, Langeweile oder Perfektionismus nicht verstehen.
Fehler Nummer zwei:
Ein Kind hat tatsächlich ADHS, ist zusätzlich aber sehr intelligent. Diese Kinder können einen Teil ihrer Schwierigkeiten durch reine Denkleistung kompensieren. Das heißt, sie fallen schulisch lange nicht negativ auf, obwohl sie extreme Probleme in Selbstorganisation, Zeitgefühl, Aufgabenplanung und Impulskontrolle haben.
Hier passiert das Gegenteil: ADHS bleibt unerkannt, weil die kognitiven Stärken das Chaos überdecken. Forschung zeigt, dass hochbegabte Kinder mit ADHS in Bereichen wie Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit trotzdem dieselben Defizite haben wie andere Kinder mit ADHS. Hochbegabung gleicht die ADHS-Symptomatik also nicht vollständig aus, sie tarnt sie nur.
Das führt dazu, dass Eltern jahrelang hören: „So clever kann kein Kind mit ADHS sein“ oder „Sie sehen doch, dass er es kann, er will nur nicht“. Beides ist falsch und verhindert Unterstützung.
Warum Lehrkräfte es kaum auseinanderhalten können
Lehrkräfte stehen unter Druck, Klassen sind groß und Verhalten muss schnell eingeordnet werden. Gleichzeitig ist es in der Praxis schwer, spontan zu unterscheiden, ob ein Kind
abschweift, weil es reizoffen ist wie bei ADHS
oderabschweift, weil das Niveau der Aufgabe weit unter seiner Denkleistung liegt.
In einer Untersuchung zur Diagnostik bei sogenannten twice exceptional Kindern wird betont, dass pädagogische Teams häufig keine ausreichende Schulung haben, um Hochbegabung und ADHS gleichzeitig mitzudenken. Das Risiko ist, dass Kinder entweder nur als hochbegabt oder nur als „verhaltensauffällig“ gesehen werden. Das Kind rutscht damit durch jedes Raster.
Für Eltern bedeutet das: Es reicht nicht, wenn die Schule sagt „Er ist halt schlau, aber unbequem“. Es reicht auch nicht, wenn eine Praxis nach einem einzigen Fragebogen sagt „ADHS, fertig“. Eine saubere Abklärung muss beides prüfen. Und zwar in verschiedenen Situationen, nicht nur in einer Testsitzung.
Du möchtest mehr zur ADHS-Diagnostik wissen? In diesem Artikel erfährst du nicht nur, wer Tests durchführt, sondern auch, wie du dich und dein Kind vorbereiten kannst.
Woran du als Elternteil hellhörig werden solltest
Du solltest genauer hinschauen, wenn du Folgendes beobachtest:
Dein Kind wirkt im Unterricht fahrig, zu Hause aber kann es stundenlang vertieft an einem Fachthema arbeiten.
Die Lehrkraft spricht von „Faulheit“, du siehst aber Überforderung durch Langeweile.
Hausaufgaben dauern ewig, obwohl dein Kind den Stoff längst verstanden hat.
Dein Kind ist emotional extrem, reagiert aber heftig vor allem dann, wenn es sich missverstanden fühlt oder Dinge zu langsam gehen.
Dein Kind kann komplexe Dinge erklären, scheitert aber an scheinbar einfachen Anforderungen wie Hefter ordentlich führen, Hausaufgaben einpacken, Zeit im Blick behalten.
Diese Mischung ist typisch für Kinder mit Hochbegabung und ADHS. Sie ist aber auch typisch für Kinder, deren Begabung völlig unterfordert ist. Das macht die Sache so kompliziert.
Die Forschung spricht von einem hohen Risiko für Fehldiagnosen, wenn man nur das Verhalten bewertet, aber nicht den Kontext, die Passung des Lernniveaus und die emotionale Lage des Kindes.
Was das konkret heißt
Hochbegabung und ADHS dürfen nicht getrennt betrachtet werden. Es geht nicht darum, eins auszuschließen. Es geht darum herauszufinden, ob
die Konzentrationsprobleme situativ sind und verschwinden, sobald das Kind geistig gefordert ist, oder
die Konzentrationsprobleme in allen Lebensbereichen sichtbar sind, auch in Lieblingsbereichen
Genau dieser Unterschied ist für die weitere Unterstützung entscheidend. Kinder, die wirklich beides haben, brauchen beides: Förderung ihrer Stärken und Unterstützung bei Exekutivfunktionen wie Planung, Struktur und Impulskontrolle.
Überschneidungen zwischen Hochbegabung und ADHS
Kinder mit Hochbegabung und ADHS teilen auf den ersten Blick viele Eigenschaften. Beide Gruppen wirken energiegeladen, kreativ, ungeduldig und häufig „gedanklich woanders“. Genau diese Überschneidungen führen dazu, dass Eltern, Lehrkräfte oder sogar Fachkräfte das eine mit dem anderen verwechseln. Dennoch steckt hinter ähnlichem Verhalten nicht immer dieselbe Ursache.
Kreativität und Ideenvielfalt
Sowohl hochbegabte Kinder als auch Kinder mit ADHS zeigen oft eine ausgeprägte Kreativität. Sie denken ungewöhnlich, stellen Fragen, die Erwachsene überraschen, und entwickeln in kurzer Zeit mehrere Lösungen gleichzeitig.
Diese Denkweise wird als „divergentes Denken“ bezeichnet und ist in beiden Gruppen stark ausgeprägt. Während sie bei Hochbegabten auf einem besonders schnellen kognitiven Netzwerk beruht, ist sie bei Kindern mit ADHS häufig das Resultat einer erhöhten Reizoffenheit und spontanen Verknüpfung unterschiedlicher Gedankenquellen.
Studien zeigen, dass Menschen mit ADHS oft besonders kreative Problemlösungen finden, wenn sie intrinsisch motiviert sind.
Hohe Energie und Antrieb
Beide Kindergruppen wirken häufig „getrieben“. Sie haben einen starken inneren Drang, sich zu bewegen, zu denken, zu gestalten oder Neues zu lernen.
Bei Hochbegabten entsteht diese Energie aus intellektueller Neugier, bei ADHS aus einer neurologischen Besonderheit im dopaminergen System, das für Motivation und Belohnung zuständig ist.
Diese Kinder erleben Routine als anstrengend, brauchen Abwechslung und Herausforderungen, um ihr Potenzial zu entfalten.
Eine Studie der Universität Nijmegen beschreibt, dass dieses hohe Aktivitätsniveau bei doppelt außergewöhnlichen Kindern (Twice Exceptional) besonders ausgeprägt ist, wenn sie unterfordert sind oder zu wenig Selbstwirksamkeit erfahren
Emotionale Intensität
Viele Eltern berichten, dass ihr Kind „zu stark fühlt“. Ob Freude, Wut oder Enttäuschung, alles scheint intensiver zu sein als bei anderen Kindern. Diese emotionale Tiefe ist typisch für Hochbegabung, tritt aber auch bei ADHS häufig auf.
Bei hochbegabten Kindern handelt es sich um eine starke emotionale Resonanz auf ihre Umwelt, während bei ADHS die Regulation dieser Gefühle schwieriger fällt. In der Kombination verstärken sich beide Effekte. Das Kind reagiert schneller, impulsiver und gleichzeitig sehr sensibel.
Neurowissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Kinder mit ADHS eine erhöhte Aktivität im limbischen System aufweisen, was emotionale Reize stärker betont.
Sprunghaftes Denken und Ablenkbarkeit
Sowohl Hochbegabung als auch ADHS können dazu führen, dass Gedanken „springen“. Hochbegabte Kinder springen, weil sie gedanklich vorausdenken, Verbindungen herstellen und sich in Ideen verlieren. Kinder mit ADHS springen, weil ihre Aufmerksamkeit leicht abgelenkt wird und sie Reize kaum filtern können.
Für Außenstehende sieht beides gleich aus: Das Kind wechselt ständig die Themen und wirkt unkonzentriert. Erst eine genaue Beobachtung zeigt den Unterschied. Während das hochbegabte Kind später erstaunlich logisch zu seiner Ausgangsfrage zurückfindet, verliert das Kind mit ADHS häufiger den roten Faden.
Perfektionismus und Selbstzweifel
Ein weniger offensichtlicher, aber bedeutender Überschneidungspunkt ist der hohe Anspruch an sich selbst. Hochbegabte Kinder spüren früh, dass sie „anders“ denken. Kinder mit ADHS erleben oft, dass sie „nicht funktionieren, wie man es von ihnen erwartet“.
In beiden Fällen entsteht daraus das Gefühl, nicht richtig zu sein. Studien zeigen, dass Kinder mit Hochbegabung und ADHS besonders gefährdet sind, negative Selbstbilder zu entwickeln, wenn sie ihr Potenzial nicht entfalten können oder häufig auf Kritik stoßen
Fazit der Forschung
Die Überschneidungen zwischen Hochbegabung und ADHS sind real und können Kinder in Schule und Familie stark herausfordern. Entscheidend ist, die Funktion hinter dem Verhalten zu verstehen.
Ein Kind, das scheinbar unkonzentriert ist, könnte in Wahrheit hochgradig interessiert sein, aber nicht gefordert werden.
Ein anderes Kind, das ständig unterbricht, könnte tatsächlich Schwierigkeiten mit Impulskontrolle haben. Nur eine ganzheitliche Betrachtung beider Seiten ermöglicht es, das Kind richtig zu verstehen und zu fördern.
Wusstest du, dass Mädchen weniger häufiger mit ADHS diagnostiziert werden? Und das, obwohl ihr Anteil genauso hoch wie bei Jungen ist?
In diesem Artikel erfährst du, warum das so ist und vor allem, woran du erkennst, ob auch dein Mädchen betroffen ist.
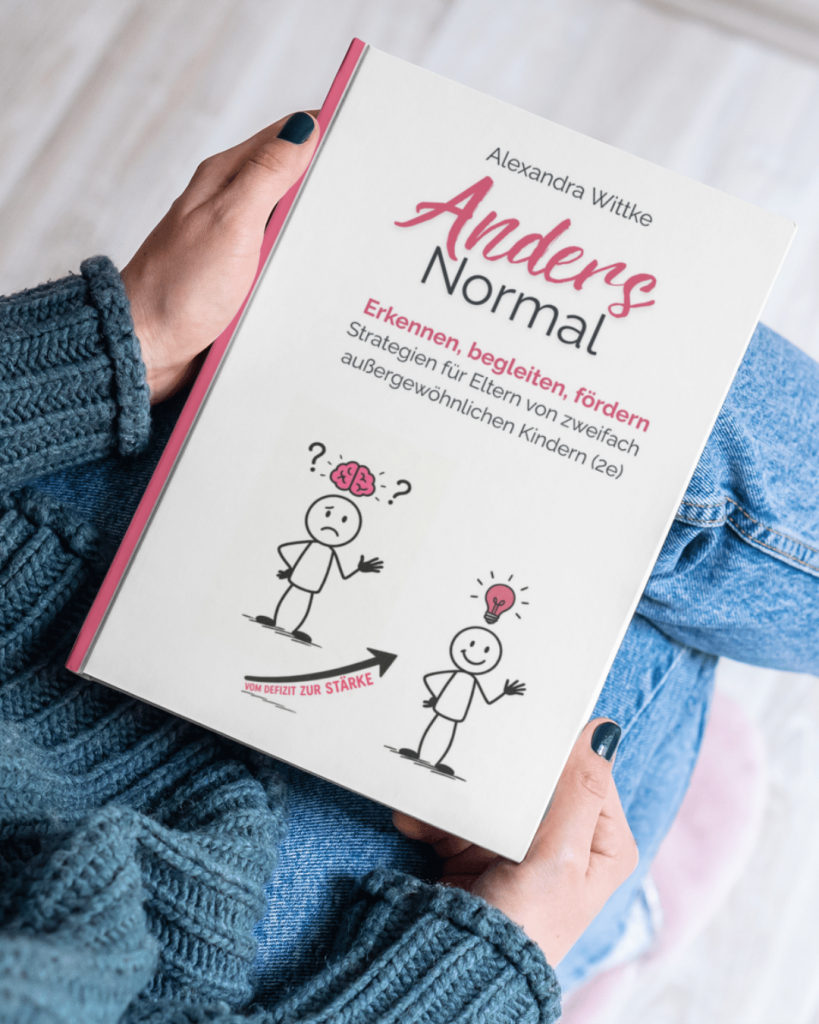
Anders Normal
Erkennen, begleiten, fördern
Dein Kind ist nicht schwierig, es ist nur anders!
„Anders Normal“ ist der erste deutschsprachige Praxisleitfaden für Eltern von zweifach besonderen Kindern – Kindern, die gleichzeitig hochbegabt und neurodivergent sind, etwa mit ADHS, Autismus oder einer Lernstörung.
Das Buch zeigt dir Schritt für Schritt,
wie du erkennst, was Twice Exceptionality (2e) wirklich bedeutet,
wie du Diagnostik und Gespräche mit Lehrkräften souverän führst,
und wie du dein Kind im Alltag, in Schule und Familie stärken kannst.
Mit verständlichem Fachwissen, echten Fallbeispielen und klaren Strategien bekommst du einen Werkzeugkoffer, um das Potenzial deines Kindes zu entfalten – ohne Druck, aber mit Struktur, Herz und Klarheit.
„Anders Normal“ ist kein theoretisches Fachbuch, sondern eine liebevolle Orientierungshilfe für Eltern, die endlich verstehen wollen, warum ihr außergewöhnliches Kind nicht in gewöhnliche Schubladen passt.
Fehldiagnosen: Wenn Hochbegabung als ADHS gilt oder umgekehrt
Die Gefahr einer Fehldiagnose ist bei Hochbegabung und ADHS besonders hoch. Beide Erscheinungsbilder zeigen sich oft in ähnlichen Verhaltensmustern. Ohne genaue Kenntnis der Hintergründe werden diese Kinder leicht falsch eingeschätzt. Eine Fehldiagnose kann gravierende Folgen haben, weil sie entweder zu unnötiger Medikation führt oder dringend notwendige Unterstützung verhindert.
Wenn Hochbegabung fälschlich als ADHS gilt
Viele hochbegabte Kinder werden unruhig, wenn sie unterfordert sind. Sie verlieren die Aufmerksamkeit, fangen an zu reden, zu kritzeln oder zu träumen. Im Unterricht wirkt das wie mangelnde Konzentration oder Impulsivität. In Wahrheit ist das Kind geistig längst weiter und sucht sich innerlich neue Reize.
In einer Studie des Institute for the Study of Advanced Development zeigte sich, dass hochbegabte Kinder, die in der Schule nicht ausreichend gefördert werden, dieselben Symptome wie Kinder mit ADHS aufweisen können. Sobald diese Kinder jedoch ein höheres kognitives Niveau erleben, verschwinden die Symptome weitgehend.
Auch der Psychologe James Webb, einer der bekanntesten Forscher zu diesem Thema, betont, dass hochbegabte Kinder oft fälschlich als hyperaktiv oder oppositionell gelten, obwohl ihr Verhalten schlicht aus Unterforderung und Langeweile entsteht. Eine Medikation, die auf Aufmerksamkeitsdefizite zielt, hilft in solchen Fällen nicht, weil die Ursache nicht im Gehirnstoffwechsel liegt, sondern in der Umgebung.
Wenn ADHS übersehen wird, weil das Kind zu leistungsstark ist
Das Gegenteil passiert ebenso häufig. Ein Kind mit ADHS, das gleichzeitig sehr intelligent ist, kann seine Schwierigkeiten jahrelang überdecken. Es versteht den Stoff schnell, schließt Wissenslücken intuitiv und gleicht chaotische Arbeitsweisen mit Denkgeschwindigkeit aus. Nach außen erscheint es deshalb „funktional“. Erst in der höheren Schule oder im Studium bricht das fragile System zusammen.
Eine Studie der Universität Padua beschreibt, dass bei Kindern mit ADHS und hoher Intelligenz die gleichen Defizite in exekutiven Funktionen auftreten wie bei Kindern mit ADHS ohne Hochbegabung. Allerdings werden sie später sichtbar, weil die intellektuelle Leistung sie zunächst kompensiert. Diese Kinder gelten oft als „faul“ oder „unmotiviert“, bis die Anforderungen komplexer werden.
Eltern berichten dann häufig von Sätzen wie „Er könnte, wenn er wollte“ oder „Sie ist zu schlau für ADHS“. Genau das führt dazu, dass betroffene Kinder keine passende Unterstützung erhalten. Viele erleben Schulversagen erst spät, obwohl die Symptome seit Jahren bestehen.
Warum standardisierte Tests oft in die Irre führen
Bei der Diagnostik kommen häufig standardisierte Fragebögen und Testverfahren zum Einsatz. Diese sind jedoch meist auf Kinder mit durchschnittlicher Intelligenz abgestimmt. Hochbegabte Kinder können dabei unauffällig erscheinen, obwohl sie deutliche Schwierigkeiten im Alltag haben.
Das ICBF Münster weist darauf hin, dass die Interpretation solcher Tests angepasst werden muss, wenn Hochbegabung vorliegt. Ein IQ-Test allein reicht nicht aus, um die Problematik zu erfassen, weil sich Hochbegabung und ADHS gegenseitig beeinflussen können. Eine zu einseitige Auswertung führt dann zu Fehleinschätzungen
Die Folgen falscher Diagnosen
Eine Fehldiagnose kann tiefgreifende Auswirkungen haben. Wird ein hochbegabtes Kind fälschlich mit ADHS diagnostiziert, erlebt es sich als „problematisch“ und „nicht richtig“. Das beeinträchtigt Selbstwert und Motivation. Umgekehrt führt eine übersehene ADHS-Diagnose dazu, dass das Kind ständig an seine Grenzen stößt und Schuldgefühle entwickelt, weil es seine eigenen Erwartungen nicht erfüllt.
Langfristig erhöht sich dadurch das Risiko für Schulvermeidung, Angststörungen oder depressive Symptome.
Eine Langzeitstudie der American Psychological Association beschreibt, dass Kinder mit falscher oder unvollständiger Diagnose ein doppelt so hohes Risiko für emotionale Belastung haben wie Kinder mit korrekt erkannter doppelt außergewöhnlicher Begabung
Wie Eltern und Fachkräfte Fehldiagnosen vermeiden können
Entscheidend ist eine Diagnostik, die beide Perspektiven einbezieht: die neurologische und die kognitive. Fachleute sprechen von einer „integrierten Diagnostik“, bei der sowohl Intelligenz, Aufmerksamkeit, Exekutivfunktionen als auch emotionale Regulation untersucht werden.
Für Eltern bedeutet das:
Suche dir Fachpersonen mit Erfahrung in Hochbegabung und ADHS.
Bestehe auf eine mehrdimensionale Diagnostik, die Schule, Familie und Verhalten in unterschiedlichen Kontexten berücksichtigt.
Vertraue deinem Gefühl. Eltern bemerken oft zuerst, wenn etwas „nicht zusammenpasst“.
Wenn beide Seiten beachtet werden, kann aus einer Fehldiagnose eine echte Chance entstehen. Denn erst dann wird sichtbar, wie viel Potenzial in diesen Kindern steckt – und was sie wirklich brauchen, um sich zu entfalten.
Was tun, wenn Hochbegabung und ADHS vorliegt?
Wenn bei einem Kind sowohl Hochbegabung als auch ADHS vorliegen, stehen Eltern und Fachkräfte vor einer besonderen Herausforderung. Das Kind ist geistig seiner Altersgruppe oft weit voraus, gleichzeitig kämpft es mit Aufmerksamkeitsproblemen, innerer Unruhe und Schwierigkeiten in der Selbstorganisation.
Die Kombination aus hoher Intelligenz und exekutiven Defiziten führt dazu, dass das Kind intellektuell begeistert, aber im Alltag häufig scheitert. Umso wichtiger ist eine Begleitung, die beide Seiten berücksichtigt: Förderung der Stärken und Unterstützung der Schwächen.
Ganzheitlich denken statt kompensieren
Kinder mit Hochbegabung und ADHS profitieren am meisten, wenn ihr Umfeld sie nicht auf ihre Schwächen reduziert, sondern die gesamte Persönlichkeit betrachtet. Das bedeutet, dass Diagnose und Förderung Hand in Hand gehen müssen. Studien zeigen, dass Kinder mit sogenannter „Twice-Exceptionality“ nur dann ihr Potenzial entfalten, wenn sie gleichzeitig Struktur und kreative Freiheit erleben.
Eine reine Förderung der Begabung ohne Struktur überfordert das Kind, reine Struktur ohne intellektuelle Herausforderung unterfordert es.
Struktur und klare Rahmenbedingungen schaffen
Kinder mit Hochbegabung und ADHS brauchen Sicherheit durch Vorhersehbarkeit. Tagesabläufe, visuelle Pläne und klare Routinen helfen, Exekutivfunktionen zu entlasten. Gleichzeitig sollte die Struktur flexibel genug bleiben, um kreatives Denken zuzulassen. Es bewährt sich, Aufgaben in kleine Schritte zu unterteilen, kurze Lernphasen zu planen und klare Anfangs- und Endpunkte zu definieren.
Fachleute empfehlen, Selbstmanagement-Strategien schrittweise zu trainieren, etwa mit To-Do-Listen, Wochenübersichten oder Apps, die an Pausen erinnern. Laut einer Untersuchung des Journal of Attention Disorders verbessern sich Motivation und Selbststeuerung, wenn Kinder lernen, Verantwortung für ihren Ablauf zu übernehmen, statt sie nur vorgegeben zu bekommen
Intellektuelle Förderung nicht vergessen
Viele Kinder mit Hochbegabung und ADHS werden ausschließlich auf ihr Verhalten reduziert. Das ist fatal, denn fehlende kognitive Stimulation verstärkt ADHS-Symptome. Eine gezielte Förderung, die den Wissensdurst stillt, sorgt dagegen für innere Ruhe. Geeignet sind projektorientierte Lernformen, Wettbewerbe oder Themen, die über den Lehrplan hinausgehen.
Das ICBF Münster weist darauf hin, dass hochbegabte Kinder mit ADHS durch anspruchsvolle Aufgaben, die zum „Flow“ führen, ihre Konzentration besser halten können
Emotionale Begleitung und Selbstwert stärken
Kinder, die anders denken und fühlen, erleben sich oft als „nicht richtig“. Sie hören Sätze wie „Du bist zu laut“ oder „Warum kannst du dich nicht einfach konzentrieren“. Diese ständigen Rückmeldungen beschädigen das Selbstwertgefühl. Eltern können gegensteuern, indem sie positives Feedback bewusst in den Alltag einbauen. Loben sollte sich auf Anstrengung, nicht auf Ergebnis beziehen.
Auch Achtsamkeits- und Entspannungsübungen haben sich als hilfreich erwiesen. Eine Metaanalyse des Journal of Child Psychology and Psychiatry zeigt, dass achtsamkeitsbasierte Programme die Emotionsregulation und Aufmerksamkeit bei Kindern mit ADHS deutlich verbessern
Zusammenarbeit mit Fachleuten und Schule
Eine gute Kommunikation zwischen Eltern, Schule und Therapeutinnen ist entscheidend. Lehrkräfte müssen wissen, dass das Kind doppelt außergewöhnlich ist. Sinnvoll ist ein gemeinsamer Förderplan, der sowohl kognitive als auch organisatorische Ziele enthält.
Es empfiehlt sich, Fördermaßnahmen regelmäßig anzupassen, weil Kinder mit Hochbegabung und ADHS Phasen extremer Leistungsschwankungen durchlaufen.
Bei Bedarf kann auch eine medikamentöse Unterstützung Teil des Gesamtplans sein, immer in enger Absprache mit Fachärztinnen. Entscheidend ist, dass Medikamente nicht als alleinige Lösung verstanden werden, sondern als Baustein in einem umfassenden Konzept, das Struktur, Förderung und emotionale Begleitung verbindet.
Was Eltern konkret tun können
Vermeide Vergleiche mit Gleichaltrigen und konzentriere dich auf den individuellen Fortschritt deines Kindes.
Achte auf ausreichenden Schlaf und regelmäßige Bewegung, um das dopaminerge System zu stabilisieren.
Fördere Selbstwirksamkeit: Lass dein Kind kleine Entscheidungen selbst treffen.
Suche Austausch mit anderen Eltern von Twice-Exceptional-Kindern, etwa in Foren oder Selbsthilfegruppen.
Halte engen Kontakt zur Schule, auch wenn es anstrengend ist. Nur Kooperation verhindert Missverständnisse.
Kinder mit Hochbegabung und ADHS sind keine Problemfälle, sondern Kinder mit außergewöhnlichem Potenzial, das auf die richtige Umgebung wartet. Wenn Förderung und Verständnis zusammenkommen, entsteht aus der Doppelbelastung eine doppelte Stärke.
Hochbegabung und ADHS
Hochbegabung und ADHS sind kein Widerspruch. Sie zeigen, wie vielfältig Kinder sein können und dass außergewöhnliche Begabung nicht immer gradlinig verläuft. Wenn beides zusammenkommt, entsteht ein Spannungsfeld aus enormem Potenzial und echten Herausforderungen. Viele dieser Kinder denken schneller, fühlen intensiver und reagieren empfindlicher auf ihre Umgebung. Genau diese Besonderheiten werden zu Stärken, wenn sie verstanden und richtig begleitet werden.
Entscheidend ist, dass Eltern und Fachkräfte nicht vorschnell urteilen. Ein Verhalten, das nach Unruhe aussieht, kann in Wahrheit Neugier sein. Ein Kind, das „träumt“, kann hochkonzentriert in Gedanken experimentieren. Und ein Kind, das mit Struktur kämpft, braucht oft keine Strafe, sondern Unterstützung beim Organisieren. Wenn Hochbegabung und ADHS gemeinsam auftreten, ist es nicht hilfreich, nur eines zu behandeln. Beide Seiten brauchen Aufmerksamkeit, das Denken ebenso wie die Emotion.
Eltern können viel bewirken, indem sie Verständnis zeigen, geduldig bleiben und auf individuelle Förderung achten. Eine gute Zusammenarbeit mit Schule und Fachleuten ist der Schlüssel, damit diese Kinder nicht als „zu viel“ oder „zu schwierig“ gelten, sondern als das, was sie sind: außergewöhnlich begabte, kreative und oft tiefgründige junge Menschen mit einem anderen Blick auf die Welt.
Wenn du dein Kind in diesen Beschreibungen wiedererkennst, lohnt sich der nächste Schritt: eine genaue Diagnostik, der Austausch mit anderen Eltern und der Mut, einen eigenen Weg zu gehen. Denn jedes Kind verdient eine Umgebung, in der es sein Potenzial entfalten darf, auch, wenn dieser Weg manchmal anders aussieht als erwartet.