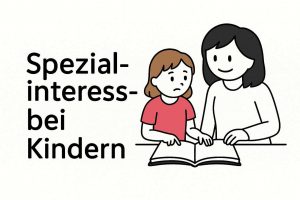Eltern und Lehrkräfte stehen oft vor der Frage, wie sie Kinder begleiten können, die gleichzeitig hochbegabt und herausgefordert sind. Diese Kinder denken blitzschnell, fühlen intensiv und reagieren sensibel auf ihre Umwelt. Eine Kombination, die fasziniert und fordert. Um zweifach aussergewöhnliche Kinder fördern zu können, braucht es ein tiefes Verständnis dafür, dass Begabung und Schwierigkeiten keine Gegensätze sind, sondern zusammengehören.
Viele dieser Kinder erleben in ihrem Alltag, dass sie entweder überfordert oder unterfordert sind. Während sie in einem Moment komplexe Themen durchdringen, stolpern sie im nächsten über einfache Aufgaben. Diese Diskrepanz ist kein Zeichen von Faulheit oder Desinteresse, sondern Ausdruck einer asynchronen Entwicklung. Der Schlüssel liegt darin, Förderung neu zu denken. Weg von Leistung, hin zu Selbstvertrauen, Motivation und Freude am Lernen.
In diesem Artikel erfährst du:
✅ Warum traditionelle Förderansätze bei 2e-Kindern oft scheitern
✅ Wie du die Stärken deines Kindes erkennst und richtig einsetzt
✅ Warum Motivation wichtiger ist als Perfektion
✅ Wie du dein Kind ermutigst, eigene Wege zu gehen
✅ Und was „Fördern statt korrigieren“ im Alltag wirklich bedeutet
Warum klassische Förderung bei 2e-Kindern oft nicht funktioniert
Viele Förderprogramme orientieren sich an klaren Kategorien: Ein Kind gilt als hochbegabt oder es braucht Unterstützung. Für Kinder, die beides sind, greifen diese Systeme kaum.
Wer zweifach aussergewöhnliche Kinder fördern möchte, merkt schnell, dass klassische Ansätze hier an ihre Grenzen kommen. Denn sie zielen meist auf Leistungssteigerung ab, und nicht auf die Entwicklung von Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit.
2e-Kinder haben ein besonderes Lernprofil. Sie begreifen komplexe Zusammenhänge mühelos, geraten aber ins Straucheln, wenn Aufgaben zu monoton oder zu eng strukturiert sind. Förderung, die auf Wiederholung, Disziplin oder Vergleich setzt, führt bei ihnen selten zu nachhaltigem Erfolg. Statt Neugier zu wecken, erzeugt sie oft Druck oder Rückzug. Diese Kinder brauchen weniger „mehr Input“, sondern Raum, in dem sie auf ihre eigene Art lernen dürfen.
Ein weiterer Stolperstein ist, dass ihre Schwierigkeiten häufig die Wahrnehmung verzerren. Wenn ein Kind bei Routineaufgaben unkonzentriert wirkt oder sich schnell frustriert, wird es leicht als „unmotiviert“ eingestuft. Tatsächlich fehlt ihm oft nicht die Motivation, sondern die Passung zwischen innerem Tempo und äusserem Rahmen. Eine passende Förderung erkennt diese Diskrepanz. Und beginnt dort, wo das Kind steht, nicht dort, wo andere es haben wollen.
Stärken als Wegweiser nutzen
Um zweifach aussergewöhnliche Kinder fördern zu können, ist es entscheidend, den Blick bewusst auf ihre Stärken zu lenken. Oft sind Erwachsene so sehr mit den Schwierigkeiten beschäftigt, dass sie vergessen, wie viel Energie, Kreativität und Neugier diese Kinder mitbringen. Dabei sind gerade ihre Interessen und Leidenschaften der Schlüssel, um Motivation, Selbstvertrauen und Lernfreude zu aktivieren.
Stärken zu erkennen bedeutet mehr, als gute Noten zu würdigen. Es heisst, wahrzunehmen, was das Kind begeistert, unabhängig vom Schulsystem. Vielleicht schreibt es Geschichten mit erstaunlicher Tiefe, denkt sich eigene Experimente aus oder stellt Fragen, auf die kaum jemand eine Antwort hat. Diese natürlichen Interessen zeigen, wo das Kind innerlich wächst, und wo Förderung Sinn ergibt.
Wenn Erwachsene Stärken gezielt als Wegweiser nutzen, verändert sich das Lernen. Aus Druck wird Neugier, aus Unsicherheit entsteht Selbstvertrauen. Es hilft, Aufgaben so zu gestalten, dass sie an das anknüpfen, was das Kind liebt. Dabei dürfen Fehler dazugehören, denn sie sind kein Scheitern, sondern Teil des Lernprozesses. Kinder, die spüren, dass ihre Fähigkeiten gesehen und geschätzt werden, entwickeln den Mut, auch schwierige Themen anzugehen. So wird Förderung zu einer Quelle von Freude statt von Stress.
Motivation statt Perfektion
Eines der grössten Missverständnisse in der Begabtenförderung ist die Annahme, dass hohe Intelligenz automatisch mit dauerhaft hoher Leistung einhergeht. In der Realität ist das Gegenteil oft der Fall:
Viele hochbegabte Kinder, besonders solche mit zusätzlichen Herausforderungen, verlieren die Freude am Lernen, wenn sie ständig das Gefühl haben, etwas „leisten“ zu müssen. Wer zweifach aussergewöhnliche Kinder fördern will, sollte deshalb Motivation über Perfektion stellen.
Studien der Karg-Stiftung und der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind (DGhK) zeigen, dass Überforderung und Leistungsdruck bei begabten Kindern zu innerem Rückzug, Selbstzweifeln und Lernblockaden führen können. Motivation entsteht nicht durch Druck, sondern durch Selbstwirksamkeit – also das Gefühl, etwas aus eigener Kraft schaffen zu können. Wenn Kinder erleben, dass sie Einfluss auf ihren Lernprozess haben, steigt ihr Engagement und ihre Belastbarkeit deutlich.
Motivation bedeutet also nicht, dass Lernen immer Spass machen muss. Es bedeutet, dass Kinder verstehen, warum sie etwas tun. Aufgaben, die an die Lebenswelt und Interessen eines Kindes anknüpfen, fördern nachhaltige Lernfreude: Ein naturwissenschaftlich neugieriges Kind darf experimentieren, ein sprachlich starkes Kind eigene Texte veröffentlichen. Entscheidend ist, dass Lernen als sinnvoll und machbar erlebt wird. So entsteht die Basis für langfristige Entwicklung – jenseits von Druck und Perfektion.
Individuelle Wege statt Einheitslösungen
Um zweifach außergewöhnliche Kinder fördern zu können, braucht es Flexibilität und Mut, von standardisierten Wegen abzuweichen. Diese Kinder lernen nicht linear, sondern in Sprüngen, Umwegen und manchmal auch Brüchen.
Ein starrer Lehrplan oder ein Förderkonzept „von der Stange“ kann dieser Vielfalt selten gerecht werden. Erfolgreiche Förderung bedeutet daher, individuelle Wege zu finden, die zu den Stärken und Bedürfnissen des einzelnen Kindes passen.
Untersuchungen der Universität Münster zur Begabungs- und Persönlichkeitsentwicklung zeigen, dass Kinder dann am meisten profitieren, wenn sie Lernwege mitgestalten dürfen. Selbstbestimmtes Lernen stärkt die Eigenmotivation und führt langfristig zu stabilerem Selbstvertrauen. Das bedeutet nicht, dass alles beliebig sein soll – sondern dass Strukturen flexibel genug sind, um Raum für Individualität zu lassen.
In der Praxis kann das ganz unterschiedlich aussehen: Ein Kind darf in Mathe Themen erforschen, die über den Stoff hinausgehen. Ein anderes bekommt mehr Zeit oder alternative Aufgabenformate, um Druck zu reduzieren. Entscheidend ist, dass Förderung kein starres Ziel verfolgt, sondern auf das Kind reagiert. Wenn Erwachsene verstehen, dass Entwicklung kein Wettlauf ist, sondern ein persönlicher Prozess, entstehen Lernumgebungen, in denen sich 2e-Kinder wirklich entfalten können.
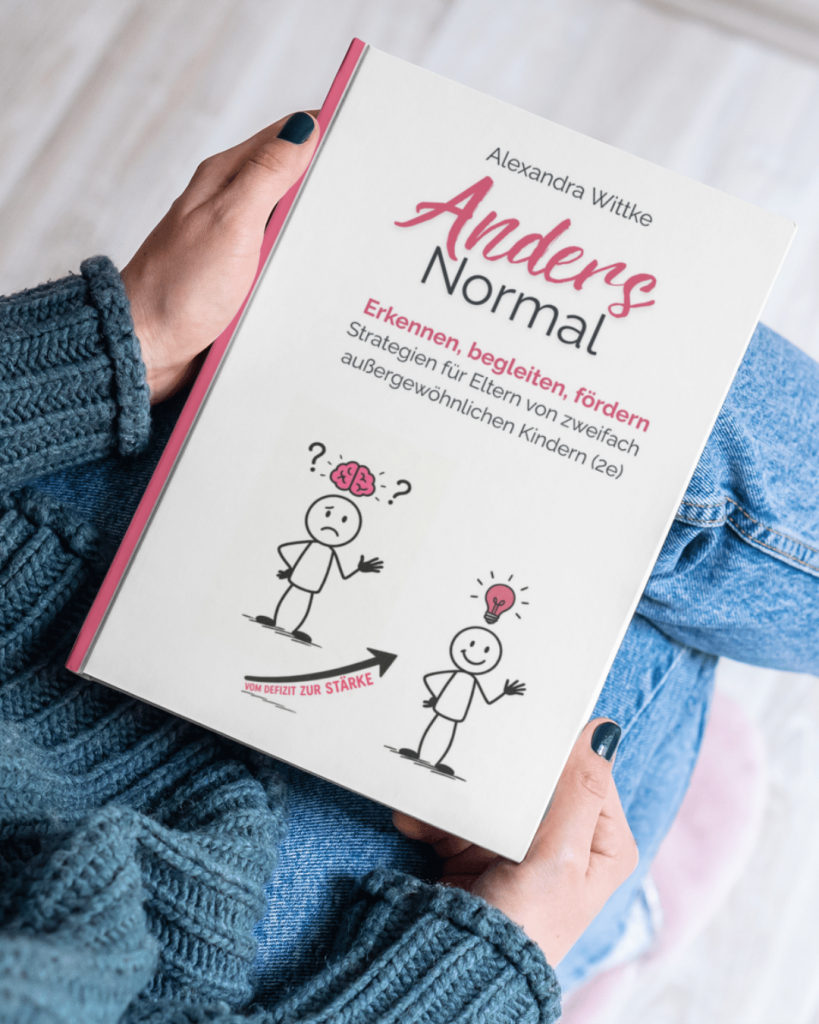
Anders Normal
Erkennen, begleiten, fördern
Dein Kind ist nicht schwierig, es ist nur anders!
„Anders Normal“ ist der erste deutschsprachige Praxisleitfaden für Eltern von zweifach besonderen Kindern – Kindern, die gleichzeitig hochbegabt und neurodivergent sind, etwa mit ADHS, Autismus oder einer Lernstörung.
Das Buch zeigt dir Schritt für Schritt,
wie du erkennst, was Twice Exceptionality (2e) wirklich bedeutet,
wie du Diagnostik und Gespräche mit Lehrkräften souverän führst,
und wie du dein Kind im Alltag, in Schule und Familie stärken kannst.
Mit verständlichem Fachwissen, echten Fallbeispielen und klaren Strategien bekommst du einen Werkzeugkoffer, um das Potenzial deines Kindes zu entfalten – ohne Druck, aber mit Struktur, Herz und Klarheit.
„Anders Normal“ ist kein theoretisches Fachbuch, sondern eine liebevolle Orientierungshilfe für Eltern, die endlich verstehen wollen, warum ihr außergewöhnliches Kind nicht in gewöhnliche Schubladen passt.
Erfolg neu definieren
In unserer Leistungsgesellschaft wird Erfolg oft mit Noten, Preisen oder messbaren Ergebnissen gleichgesetzt. Für Kinder, die anders lernen und denken, ist das jedoch kein realistischer Maßstab. Wer zweifach außergewöhnliche Kinder fördern möchte, sollte Erfolg nicht an Erwartungen, sondern an Entwicklung messen. Für ein 2e-Kind kann ein erfolgreiches Jahr bedeuten, dass es gelernt hat, um Hilfe zu bitten, mit Frustration umzugehen oder wieder Freude am Lernen zu finden, auch das sind grosse Schritte.
Psychologische Forschung, etwa von Linda Silverman (Gifted Development Center, USA), zeigt, dass Kinder mit hoher Begabung und zusätzlichen Herausforderungen vor allem dann aufblühen, wenn sie in einer Atmosphäre von Akzeptanz und Sinnhaftigkeit lernen. Es geht weniger darum, Defizite zu beseitigen, als darum, Stärken als Träger von Motivation zu nutzen. Wenn Kinder spüren, dass sie mit ihren besonderen Fähigkeiten etwas beitragen können, entsteht intrinsische Motivation – der eigentliche Motor für Wachstum.
Eltern und Lehrkräfte können hier viel bewirken, indem sie kleine Fortschritte sichtbar machen. Lob für Anstrengung und Durchhaltevermögen ist wertvoller als für Ergebnisse. So lernen Kinder, dass sie Einfluss auf ihre Entwicklung haben, auch dann, wenn nicht alles perfekt läuft. Erfolg wird so zu einem individuellen Weg, der sich an der persönlichen Entfaltung orientiert, nicht an Vergleich oder Anpassung.
Wie Förderung im Alltag aussehen kann
Theorie ist wichtig, aber echte Veränderung entsteht im Alltag. Wer zweifach außergewöhnliche Kinder fördern will, muss Wege finden, die zu den individuellen Lebenssituationen passen. Oft sind es kleine, konsequent umgesetzte Anpassungen, die den grössten Unterschied machen.
Beispiel 1: Der Denker, der nicht startet
Lukas, 10 Jahre, liebt Zahlen. In Mathe versteht er komplexe Konzepte sofort, verliert sich aber im Schreiben der Zwischenschritte. Seine Lehrerin lässt ihn deshalb zuerst mündlich erklären, wie er denkt, bevor er Aufgaben schriftlich löst. So bleibt die Denkleistung sichtbar, ohne dass die Handschrift zum Stolperstein wird.
Beispiel 2: Die Perfektionistin, die scheitert
Mara, 11 Jahre, ist kreativ und hat tausend Ideen, doch sie bricht Aufgaben ab, wenn sie nicht perfekt gelingen. Ihre Eltern führen ein „Mut-Tagebuch“ ein, in dem Mara jeden Tag notiert, was sie ausprobiert hat, auch wenn es nicht geklappt hat. Das stärkt ihr Selbstvertrauen und reduziert den Druck, immer alles richtig zu machen.
Beispiel 3: Der Träumer, der zu viel denkt
Jonas, 9 Jahre, denkt tief und verliert sich in Fantasien. In der Schule wirkt er „abwesend“, obwohl er gedanklich längst beim nächsten Thema ist. Seine Lehrerin erlaubt ihm, kurze Gedankenpausen einzulegen oder Ideen auf kleine Zettel zu schreiben. Das hilft ihm, fokussiert zu bleiben, ohne seine Kreativität zu unterdrücken.
Diese Beispiele zeigen: Förderung muss nicht perfekt sein, sie muss passend sein. Wenn Erwachsene bereit sind, hinzusehen, zuzuhören und flexibel zu reagieren, können zweifach außergewöhnliche Kinder zeigen, was wirklich in ihnen steckt.
Zweifach außergewöhnliche Kinder fördern
Wer zweifach außergewöhnliche Kinder fördern möchte, braucht Geduld, Neugier und den Mut, neue Wege zu gehen. Diese Kinder entziehen sich einfachen Konzepten, sie lernen anders, denken anders und fühlen intensiver. Doch genau das ist ihre Stärke. Wenn Erwachsene aufhören, sie zu korrigieren, und stattdessen beginnen, ihre Stärken bewusst zu begleiten, verändert sich alles: Lernen wird wieder lebendig, Motivation kehrt zurück, und das Kind kann wachsen, ohne sich verbiegen zu müssen.
Fördern bedeutet nicht, Erwartungen zu erfüllen, sondern Potenziale sichtbar zu machen. Es heisst, das Kind zu sehen, wie es ist, nicht, wie es „sein sollte“. Kleine, echte Erfolge sind oft wertvoller als grosse Sprünge. Wenn Kinder erleben, dass ihre Besonderheiten willkommen sind, entsteht das, was klassische Förderung selten erreicht: innere Sicherheit.
Am Ende geht es nicht darum, dass 2e-Kinder perfekt funktionieren, sondern dass sie lernen, sich selbst zu vertrauen. Denn jedes Kind, das sich verstanden und angenommen fühlt, hat die beste Grundlage, um sein Potenzial zu entfalten, auf seine ganz eigene, aussergewöhnliche Weise.
Meine Empfehlungen für dich
Wenn du tiefer verstehen möchtest, wie man Kinder mit doppelter Besonderheit im Alltag begleiten kann, lies weiter in den bisherigen Teilen dieser Reihe:
Erfahre, was hinter dem Begriff steckt, und warum diese Kinder so besonders sind:
Was bedeutet Twice Exceptional?
Warum 2e-Kinder durchs Raster fallen, und was du tun kannst, wenn dein Kind „nicht gesehen“ wird:
Zweifach außergewöhnliche Kinder werden oft übersehen
Praktische Strategien für Eltern und Lehrkräfte, um Balance und Verständnis zu schaffen: